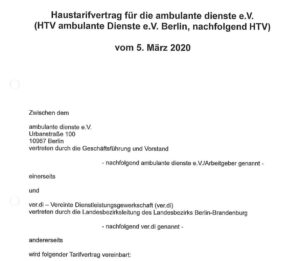Allenthalben ist von einer »neuen Arbeitskultur« die Rede, von »Arbeit 4.0«. »Motivation«, »Produktivität«, »Kreativität« lauten die Keywords. Doch was steckt hinter diesen Etiketten? Die »schöne neue Arbeitswelt« entpuppt sich oft als wenig schön und wenig neu. Unter Ökonomisierungs- und daraus resultierendem Leistungsdruck nimmt nicht zuletzt der Angriff auf die Gesundheit zu.
Allenthalben ist von einer »neuen Arbeitskultur« die Rede, von »Arbeit 4.0«. »Motivation«, »Produktivität«, »Kreativität« lauten die Keywords. Doch was steckt hinter diesen Etiketten? Die »schöne neue Arbeitswelt« entpuppt sich oft als wenig schön und wenig neu. Unter Ökonomisierungs- und daraus resultierendem Leistungsdruck nimmt nicht zuletzt der Angriff auf die Gesundheit zu.
Wolfgang Hien legt die Finger in die Wunden »unserer« Arbeitsgesellschaft. Dabei weist der Autor nach, dass Ziele, Zwecke und Bedingungen der Arbeitswelt, der wir ausgesetzt sind, nicht von »uns«, auch nicht von anonymen Marktgesetzen, sondern von Macht- und Herrschaftsstrukturen und insofern von konkreten Akteuren der Wirtschaftseliten bestimmt werden.
Wolfgang Hien – Kranke Arbeitswelt – Ethische und sozialkulturelle Perspektiven
200 Seiten | 2016 | EUR 16.80 – ISBN 978-3-89965-703-6
 Kontext – Material – Rezeption
Kontext – Material – Rezeption
Es gibt – seit langem mal wieder – stürmische Herbsttage, an denen die Welt wie aus Glas wirkt. Dann verkürzen sich die Entfernungen, bis sie verschwinden, und im durchsichtigen und kaltem Licht scheint alles in einem einzigen Punkt zu verschmelzen: wo man immer auch ist, man ist überall! Manchmal dagegen ist alles fahl Grau, wie ein Klotz aus massivem Fels! Und die Ströme von Leben, die die symmetrischen Straßen durchfließen, versiegen bis auf ein taubes Zittern entlang der Risse, die es ädern! – Lavorare in Fiat
Aus der Einleitung
Krankheit erzeugt in manchen Ohren einen durchaus positiven Klang: An Krankheit lässt sich mittlerweile viel verdienen. Durch die schwarz-rot-grün befürwortete Einführung der Fallpauschalen und die politisch gewollten und gnadenlos durchgepeitschten Ökonomisierungs-Diktate mutiert das Gesundheitswesen zur »Gesundheitswirtschaft«. Die Leidtragenden sind nicht einmal hauptsächlich die Kranken, denn viele Ärzte und Ärztinnen und so gut wie alle Pfleger und Schwestern, die Altenpfleger*innen, die Physiotherapeut*innen sowie die Vielzahl der anderen im Gesund-heitswesen engagierten Beschäftigten geben mehr, viel mehr als das, was ihnen die Gesundheitsökonomie zuweist. Die hauptsächlich Leidtragenden sind die Gesundheitsarbeiter*innen, insbesondere die Krankenhausarbeiter*innen. Deren Arbeitsleistung geht in den letzten Jahren weit über das erträgliche Maß der Belastbarkeit hinaus. Und ein Ende dieses unhaltbaren Zustandes ist nicht abzusehen.
»Alles soll bestens und toll sein. Alle unvollkommenen, proble-matischen, schwachen, alle eher negativen Seiten werden weitgehend verleugnet. Dies gilt für alle Ebenen und von Konflikten, die man mit anderen, mit sich selbst, mit der Arbeit und Vorge-setzten oder sonstigen hat. Die ganze Konfliktseite wird abgespalten, aber auch die ganze Seite des negativen Erlebens. Negative Gefühle zu haben, also etwa auf jemand anderen wütend, ärgerlich zu sein, Angst zu haben, von Skrupeln geplagt zu werden, ist immer ein Indiz dafür, dass man sozusagen nicht zu den Gewinnern gehört. Und deshalb müssen solche Aspekte vor sich selbst ausgeblendet werden.«
»Am Fließband war völlig egal, ob du schön oder ›vorzeigbar‹ bist«
Die ersten Aufsätze des Buches lehren das Grauen. Hunderttausende von Arbeiter*innen wurden über Jahrzehnte Asbest ausgesetzt; Jahre später begann das große Sterben an Lungen- oder Bauchfellkrebs, das bis heute anhält – über 20 Jahre nach dem Asbest-verbot in Europa. Die Arbeitsmedizin verharmloste wissentlich die lange bekannten Gefahren und wälzte die Folgen auf die Arbeiter*innen ab. Viele Berufskrankheiten wurden inzwischen zusammen mit den besonders krankmachenden Arbeiten inzwischen »outgesourct« – nach Indien, Pakistan, Bangladesh. Weltweit sterben jährlich über 100.000 Arbeiter*innen an Asbest. Der »Nestor« der deutschen Arbeitsmedizin erwarb seine Erkenntnisse in der NS-Zeit und konnte damit nach dem Krieg in BRD und DDR weiter die Leitlinien setzen – weitgehend unkritisiert, da ja die sozialethisch orientierte Medizin mit ihren jüdischen Trägern ausgerottet worden war. Hien kritisiert, dass bis heute eine auf der Konstitutionsmedizin beruhende Selektion betrieben wird zwischen »widerstandsfähigen« und nicht widerstandsfähigen Menschen.
 Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in der BRD arbeitet unter körperlich harten Bedingungen – gerade in schlecht bezahlten sogenannten Dienstleistungsjobs. Auch heute wird in Arbeiter-stadtteilen zehn Jahre früher gestorben. Menschen unterer Klassen gelten der Medizin immer noch als weniger wertvoll. Zumindest wenn sich mit ihren Krankheiten nichts verdienen lässt. Das sei nicht das in den 80er Jahren beschworene »Ende der Arbeit«, sondern Verelendung im Marxschen Sinne.
Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in der BRD arbeitet unter körperlich harten Bedingungen – gerade in schlecht bezahlten sogenannten Dienstleistungsjobs. Auch heute wird in Arbeiter-stadtteilen zehn Jahre früher gestorben. Menschen unterer Klassen gelten der Medizin immer noch als weniger wertvoll. Zumindest wenn sich mit ihren Krankheiten nichts verdienen lässt. Das sei nicht das in den 80er Jahren beschworene »Ende der Arbeit«, sondern Verelendung im Marxschen Sinne.
Hien kritisiert den im Vergleich zur Aufbruchsstimmung in der Medizinkritik und der Gesundheitstag-Bewegung verengten Blick in der betrieblichen Gesundheitspolitik heute oder in gewerkschaft-lichen Debatten über Arbeit und Gesundheit. Die Mitbestimmungs-kultur in den Selbstverwaltungsorganen der Berufsgenossenschaften betreibe nur eine Mitverwaltung des Elends. Und was nutzt eine Anti-Stress-Verordnung der IG Metall, wenn nicht über Personal-bemessung die quantitativen Voraussetzungen zur »Entstressung« der Arbeitsabläufe geschaffen werden. (S. 104) Eine von den Gewerkschaften beworbene Handlungsanleitung trägt den Titel »Gesundheit und Beteiligung in Change-Prozessen«. Sie enthält beschwörende Formeln wie »vertrauensvolle Unternehmenskultur«, »humane Managementmethoden« und »fairer« Veränderungs-prozess »auf Augenhöhe«. (S. 106f.) Der Autor ist immer wieder fassungslos über die Ideologisierung von Realität und Begrifflichkeit, die verdeckt, worum es in Wirklichkeit geht: Löhne kürzen, Schwache aussortieren, Druck ausüben. Wer eine radikale Arbeits-zeitverkürzung vorschlägt, um gesundheitliche Risiken zu minimieren, gelte heute schon als »Ewiggestriger«.
In die Texte fließen Erfahrungen aus Seminaren mit Betriebsräten, Gutachten auf der Grundlage einer »Teilnehmenden Beobachtung« am Arbeitsplatz, Emails und Briefe von betroffenen Arbeiter*innen ein. Die Menschen, die der »kapitalistische(n) Landnahme im Gesundheitswesen« (so eine Kapitelüberschrift) ausgesetzt sind – als Patienten oder als dort Beschäftigte – sind auch die Hauptadressaten des Buches. Mit der Veränderung der Arbeitsverhältnisse verändern sich auch die Krankheitsbilder: Burn-out und psychische Erschöpfungszustände ersetzen zunehmend die Massenkrankheiten des Bewegungsapparates. Die neuen Verhältnisse wollen die ganze Person, sie soll alles geben, kreativ, motiviert, flexibel, aber vor allem auch loyal sein. »Feierabend« gibt es nicht mehr. Seine Arbeit machen, reicht heute nicht mehr. »Am Fließband war völlig egal, ob du schön oder ›vorzeigbar‹ bist« (S. 87)
Die Arbeits- und Lebensverhältnisse im gegenwärtigen Post-Fordismus oder Post- Taylorismus seien für manche interessanter geworden, schreibt Hien an anderer Stelle. Gleichzeitig gebe es eine massive Re-Taylorisierung – sogar in den kreativen Bereichen der IT-Arbeit. Bemerkt wird eine Anpassung an die Verhältnisse: das Schielen auf ökono-mische Vorteile verdirbt den Charakter, der Konkurrenzkampf macht krank, der Körperkult blendet Anderssein, Krankheit und Tod aus. Hien nennt das Ergebnis eine »neue Art von Klassengesellschaft« Ein Nützlichkeitsrassismus mache sich breit, der die Minderleister ausgrenze und die soziale Ungleichheit bejahe. Die skandalös wachsende Kluft zwischen Eliten/oberer Mittelschicht und den breiten Massen mache epidemologisch nachweisbar krank. (S. 156)
Die neue arbeitswissenschaftliche und arbeitspsychologische Literatur thematisiere durchaus den Angriff auf die Gesundheit, aber mit ihrer Kritik bleibe sie weit hinter dem zurück, was notwendig wäre. Vielen Titeln hafte der Geruch der »Anpassung« an – Anpassung an vorgegebene Förderprogramme überwiegend staatlicher Auftraggeber. Motivation, Produktivität und insbesondere »Beschäftigungsfähigkeit« werden als Zielvorgabe gesetzt. Dabei bliesen die »Ratgeber-Literatur« und gewerkschaftliche Gesundheitspolitiker häufig ins gleiche Horn: statt die Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu thematisieren, sehen sie die Lösung in »Bewältigungsstrategien« und »Resilienz«. Letztere suggeriere, dass es vor allem in der Hand des Einzelnen liege, die eigene Wider-standskraft zu stärken durch gesunde Ernährung, Sport usw. Die strukturellen Ursachen werden als gegeben hingenommen. Solch ein individualisierender Umgang stabilisiere die prekären »neoliberalen« Verhältnisse.
Aufschlussreich ist die im Buch abgedruckte Debatte mit der Grundrisse-Redaktion darüber, ob die »postfordistischen« Verhältnisse den Arbeiter*innen mehr Möglichkeiten geschaffen haben oder ganz im Gegenteil: dabei wird er so verstanden, als wolle er zurück zu den ›goldenen Zeiten‹ der Arbeiterklasse!

Was setzt er dagegen?
Hien meint, Arbeit werde immer auch einen belastenden Effekt haben. Arbeit habe ein Doppelgesicht: Arbeit sei nicht wirkliches Leben, aber Arbeit sei selbst Leben. Die materiellen Grundlagen müssen verändert werden durch eine radikale Arbeitszeit-verkürzung. Um den Leuten, die nicht mehr können, den Druck zu nehmen, fordert er ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Es geht ihm darum, Emanzipation und Aufklärung zu fördern, (S. 89) das Glücks-versprechen des Kapitalismus auseinandernehmen (S. 90) und Gegenkulturen aufzubauen (S. 102). Auch die die innere Haltung der Beschäftigten muss sich ändern. In den Gesundheitsberufen fordert er eine andere Ethik in der Behandlung der kranken Menschen unabhängig von der Herkunft oder Leistung.
Einer kritischen Theorie des Subjekts widmet er das letzte Kapitel. Dabei kritisiert er u. a. eine Frauen- und Genderforschung, in der sich der Dekonstruktivismus als gute Möglichkeit erweise, insbesondere marxismusverdächtige Theorien aus der Wissen-schaftslandschaft zu vertreiben. (S. 162) Er fragt sich, ob politisches Handeln überhaupt noch möglich ist, wenn es kein autonomes Subjekt mehr gibt, sondern wir uns als ewig fragmentiert und dezentriert begreifen müssen?
Hierzu holt er im letzten Aufsatz »Leiblichkeit« weit aus und wagt einen schwierigen Ritt über Marx, Nietzsche, Husserl, Merleau-Ponty zu Adorno und Judith Butler, Identität und Nicht-Identität. Er landet bei der Bedeutung des Anderen, der Gemeinschaft, die sogar die Epigenetik bestätigen könne. Er visiert eine »Gemeinschaft freier Menschen in all ihren Unterschiedlichkeiten« an, die weder das »Zwangskollektiv im Arbeitsprozess«, noch auf eine »einheitliche und eindeutige kollektive Identität« gegründet sei. Dieses »Werden in Gemeinschaft« (Butler) ersetze »die Idee des souveränen, solistisch oder avantgardistisch oder handelnden autonomen Subjekts«. Er schließt mit der Auffor-derung, »den Schmerz in ein Rufen, in ein Schreien, zu verwandeln und damit das leibliche Werden in Gemeinschaft – in den Raum des Politischen hinein – zu konstituieren«. Was das nun genau heißt – diese Auseinandersetzung ist zu führen.
John Holloway: Vom Schrei der Verweigerung zum Schrei der Macht
Am Anfang war der Schrei. Ein Schrei der Erfahrung. Ein Schrei der Angst, ein Schrei des Entsetzens. Ein Schrei darüber, wie wir leben und was wir sehen, ausgelöst von den Zeitungen, die wir lesen, den Fernsehprogrammen, die wir sehen, unseren alltäglichen Konflikten. Ein Schrei, der nicht akzeptiert, daß es massenhaften Hunger neben Überfluß gibt, daß soviel Arbeit und Ressourcen der Zerstörung des menschlichen Lebens geopfert werden und daß sich der Schutz des Privateigentums in einigen Teilen der Welt nur durch den systematischen Mord an Straßenkindern organisieren läßt. Ein Schrei der Verwei-gerung.
Ein Schrei voller Mißtöne, disharmonisch und oft undeutlich: manchmal nur ein Murmeln, hin und wieder mit Tränen der Enttäuschung, manchmal ein siegessicheres Brüllen – in jedem Fall zeigt er, daß die Welt auf dem Kopf steht, falsch ist. Aber wie kommen wir über diesen Schrei hinaus? Wie begreifen wir die Welt als auf dem Kopf stehend, falsch und negativ? In den Medien, den Büchern, in der Schule und in der Sozialwissenschaft wird die Gesellschaft fast immer positiv dargestellt. Im Studium der Sozialwissenschaft lernen wir, »wie es ist«. Dies »wie es ist« läßt sich kritisieren, aber zwischen dem, was ist, und unseren emotionalen Reaktionen wird ein klarer Unterschied gemacht. Der Schrei ist nicht gerade eine zentrale Kategorie der Sozialwissenschaft. Tatsächlich begründet die Sozial-wissenschaft ihren wissenschaftlichen Anspruch genau mit dem Ausschluß des Schreis. Die Beschäftigung mit der Welt, wie sie ist, positiv bestimmt, wirft unsere Negativität auf uns zurück, definiert die Negativität als unser individuelles Problem, als Ausdruck unserer mangelnden Anpassungsfähigkeit. Man bringt uns bei, daß ein vernünftiges Begreifen der Welt nichts mit unseren privaten sentimentalen Reaktionen zu tun habe.