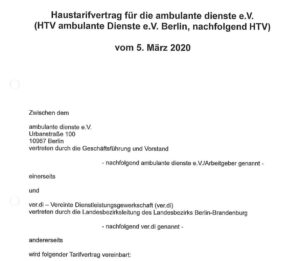Um das Staatsdefizit zu senken, setzt die britische Regierung auf Marktstrukturen, auf Auslagerung und Privatisierung – auch im Gesundheitssystem. Nicht nur MedizinerInnen befürchten die Abschaffung einer der besten Errungenschaften des britischen Sozialstaates.
Krankheit soll sich lohnen (von Matthias Becker)
Im Herbst 2009 trat die konservative Gemeindeverwaltung von Barnet, einem Bezirk in Nordlondon, mit einer neuen Idee an die Öffentlichkeit. Statt allen BürgerInnen dieselben öffentlichen Dienstleistungen zu bieten, würde der Bezirk in Zukunft eine Auswahl zur Verfügung stellen. Wer in Barnet auf eine Baugenehmigung nicht warten will, dessen Antrag wird schneller bearbeitet – gegen einen kleinen Aufpreis, versteht sich. Und ältere MitbürgerInnen können sich entscheiden, ob sie ihren finanziellen Zuschuss lieber für eine Reinigungskraft oder eine Krankenpflegefachkraft ausgeben wollen.
«Es wird Zeit, dass der öffentliche Dienst Kundenservice so betreibt, wie es im Privatsektor üblich ist», erklärte Mike Freer, der damalige Gemeindevorsteher, der Presse. Die britischen Zeitungen und Fernsehsender tauften das Programm, mit dem die Konservativen die Gemeindeverwaltung umkrempelten, bald das «Easyjet-Modell», nach der Billigfluggesellschaft. Das Interesse war besonders gross, weil Barnet als Modell gehandelt wurde, wie die Sparpolitik einer künftigen konservativen Regierung aussehen könnte. Die Wahlfreiheit der «KonsumentInnen von öffentlichen Diensten» war dabei allerdings nur ein medienwirksamer Nebenaspekt. Zentral daran waren vielmehr massive Leistungskürzungen und Auslagerung der Dienste an Privatfirmen. Denn Barnet muss sparen, wie alle britischen Städte und Gemeinden, seit das Staatsdefizit in der Finanzkrise in die Höhe schoss.
Sparen, wo es nur geht
Barnet ist kein armer Bezirk – am nördlichen Rand der Metropole fast schon im Grünen gelegen, ist er geprägt von der englischen Mittelschicht. Dennoch sind die Folgen der Krise der Gemeindefinanzen unübersehbar: Bibliotheken und Jugendzentren schliessen, Schulen entlassen Lehrer und Sozialarbeiterinnen. Bei den Regionalwahlen 2010 behaupteten die Konservativen noch ihre Mehrheit im Gemeinderat. Aber mittlerweile ist die Stimmung in der Bevölkerung gekippt. Dazu beigetragen haben stark gestiegene Parkplatzgebühren, ein wichtiges Thema in Barnet. Doch vor allem ein Skandal, bei dem die Verwaltung viele ihrer Angestellten im Sicherheitsbereich entlassen hatte, nur um dann die Aufträge an eine dubiose private Sicherheitsfirma zu vergeben, die zuvor nicht auf ihre Seriosität hin überprüft worden war und die in der Zwischenzeit Konkurs anmelden musste. «Das Motto des Bezirks ist: Kürzen, bezahlen lassen und privatisieren!», schimpft denn auch Vicky Morris, eine Sprecherin von «Barnets Bündnis für öffentliche Dienste».
Ob auf lokaler oder nationaler Ebene – Privatisierung gilt der britischen Regierung als Mittel der Wahl, um die Staatsschulden abzubauen. «Eine grössere Zahl unterschiedlicher Anbieter wird Innovation und Effizienz steigern, weil sie zu mehr Wettbewerb und mehr Wahlmöglichkeiten für die Konsumenten führt», hiess es entsprechend im November 2010 in einer Regierungserklärung der liberal-konservativen Koalition. Zu den «unabhängigen Anbietern» zählt die Regierung «ehrenamtliche und Gemeindeorganisationen, gemeinnützige und private Unternehmen». Mögliche Betätigungsfelder sind das Sozialwesen, die Justiz und die Bewährungshilfe, aber auch die Vergabe von Führerscheinen und sogar das Eintreiben von Steuern.
Private Unternehmen sollen auch am Gesundheitssystem des Landes, dem National Health Service (NHS), stärker beteiligt werden. Ein umstrittener Gesetzesentwurf der Regierung – die Health and Social Care Bill – sieht vor, dass staatliche und private AnbieterInnen von Behandlungen, Medikamenten oder medizinischem Gerät gleichgestellt würden. Staatliche Einrichtungen, Wohltätigkeitsverbände oder Privatunternehmen sollen künftig alle mit ihren «Gesundheitsleistungen» das nationale Gesundheitssystem beliefern dürfen.
Das erklärte Ziel des Entwurfs ist es, durch konkurrierende AnbieterInnen von Gesundheitsleistungen nicht nur die Effizienz zu steigern, sondern vor allem Kosten zu senken. Eine unabhängige Aufsichtsbehörde soll dabei Monopolbildung und unfaires Marktverhalten bekämpfen und dadurch «wirklich gleichberechtigte Wettbewerbsbedingungen schaffen», sagte Premierminister David Cameron in einer Rede Anfang Juni. Unter anderem würde dies bedeuten, dass Privatunternehmen höhere Preise für gleiche Leistung erhalten, um so die Wettbewerbsvorteile staatlicher Einrichtungen auszugleichen – weil sie schliesslich Steuern zahlen!
Radikale Umgestaltung
Ganz wie die EinwohnerInnen des Londoner Bezirks Barnet sollen auch die britischen PatientInnen mehr Auswahl bekommen. Künftig können sie sich in jeder Arztpraxis oder jedem Krankenhaus im Land behandeln lassen. Die Regierung betont immer wieder, dass sie die Wahlfreiheit der PatientInnen stärken will. KritikerInnen hatten bemängelt, der Gesetzesentwurf enthebe das Gesundheitsministeriums der Verplichtung, unabhängig von der Region für ausreichende und umfassende Behandlungsmöglichkeiten zu sorgen. Premierminister David Cameron hat nun am Dienstag versichert, diese Verpflichtung bleibe weiter bestehen.
Gleichzeitig wird die bisherige Verwaltungsstruktur radikal umgestaltet. Regionale Arbeitsgemeinschaften von ÄrztInnen sollen über den medizinischen Bedarf entscheiden und zwischen den verschiedenen «Anbietern von Gesundheitsleistungen» wählen. Besonders brisant an dieser Form der Budgetierung wäre, dass künftig ÄrztInnen darüber entscheiden würden, wofür die vorgegebenen und bereits knappen Ressourcen ausgegeben werden – Kürzungen von unten sozusagen.
Jonathan Tomlinson ist von dieser Aussicht überhaupt nicht begeistert. Er ist im Vorstand von «Keep Our NHS Public», einem Bündnis der GegnerInnen der Gesundheitsreform. «Das Gesetz schafft eine künstliche Spaltung zwischen uns Ärzten und dem Rest des medizinischen Sektors. Wir werden zu ‹Einkäufern› oder ‹Auftragsvergebern› erklärt, die anderen zu ‹Anbietern›, die dann ‹befreit› werden, um mit Privatfirmen zu konkurrenzieren.»
Wie viele seiner KollegInnen befürchtet der Arzt, der eine Praxis in London hat, eine Zersplitterung des Systems. Spezialisierte private Praxen und Krankenhäuser würden sich die einfachsten PatientInnen zur Behandlung aussuchen, während die staatlichen Einrichtungen weiterhin die schwierigen und daher teuren Fälle betreuen müssten. «Bisher können die staatlichen Krankenhäuser Gelder intern zwischen den verschiedenen Abteilungen umverteilen», sagt Tomlinson. «Aber wenn Privatfirmen ihnen die lukrativsten Behandlungen abnehmen, geht das nicht mehr! Dann bleiben ihnen noch die kostenintensive Notfallambulanz und die Entbindungsstation.» Es sei absehbar, sagt Tomlinson, dass viele Krankenhäuser schliessen müssten, wenn die Reform wie geplant in Kraft tritt – nicht weil die PatientInnen sie nicht bräuchten, sondern weil sie in der harten Konkurrenz auf dem Gesundheitsmarkt nicht bestehen könnten.
Der geplante Umbau des Gesundheitssystems ist unpopulär; laut Meinungsumfragen ist ein grosser Teil der Bevölkerung gegen die Reform. Für die Regierung stellt das Vorhaben ein politisches Risiko dar, da das Gesundheitssystem von den BritInnen quasi als «der grösste Schatz des Landes» betrachtet wird. Cameron versuchte deshalb im Wahlkampf, das Misstrauen der Bevölkerung zu zerstreuen, die Konservativen würden nach der Parlamentswahl die Axt an den NHS anlegen. Vollmundig sagte er, seine Prioritäten liessen sich mit drei Buchstaben ausdrücken: N – H – S.
Taktische Rückzüge
Aber angesichts der seit der Finanzkrise vorgegebenen Sparziele hat die Regierung kaum eine andere Wahl. Bereits jetzt steht fest, dass der NHS in den nächsten vier Jahren umgerechnet etwa 27 Milliarden Schweizer Franken an «Verwaltungskosten» einsparen muss. Das entspricht einer jährlichen Kürzung des Gesamtbudgets um vier Prozent. Gesundheitsminister Andrew Lansley behauptet, das sei möglich, ohne dass die PatientInnen deshalb schlechter behandelt würden.
Widerstand kommt vor allem von den Gewerkschaften und den medizinischen Fachverbänden, etwa der British Medical Association. Deren renommiertes Fachblatt «British Medical Journal» warnte sogar vor der drohenden «Abschaffung» des NHS. Als die Kritik im Frühjahr immer lauter wurde, reagierte die Regierung, indem sie sich selbst eine «Denkpause» verordnete.
GesundheitsarbeiterInnen und die Bevölkerung hatten die Möglichkeit, bei Informationsveranstaltungen ihre Anliegen einzubringen, und die Fachverbände nahmen zum Entwurf Stellung. Ende Mai wurde der Gesetzesentwurf in die parlamentarischen Arbeitsgruppen zurückverwiesen, und deshalb wird er frühestens im Herbst verabschiedet werden. Noch immer plant die Regierung, dass die Reform Anfang 2013 in Kraft treten soll. Doch das scheint nur schon wegen des enormen organisatorischen Aufwands kaum möglich.
Premierminister Cameron verkündete der britischen Öffentlichkeit kürzlich unter anderem, er garantiere «persönlich», dass die Gesundheitsreform nicht zu einem «Ausverkauf des NHS» führen werde. Doch «die angeblichen Zugeständnisse des Premierministers sind bedeutungslos», sagt Jonathan Tomlinson. «Alle problematischen Vorschläge stehen nach wie vor im Gesetz.» Er glaubt nicht, dass die britische Öffentlichkeit bereits begriffen hat, dass bei der Reform die «integrierte und umfassende Gesundheitsversorgung für das ganze Land» auf dem Spiel steht.
Kosten, Kosten – Krankenhäuser können in Konkurs gehen
Das britische Gesundheitssystem, der National Health Service (NHS), entstand nach dem Zweiten Weltkrieg und war bisher ein wesentlicher Bestandteil des modernen Sozialstaats Britanniens. Er ist eines der wenigen ausschliesslich steuerfinanzierten Gesundheitssysteme der Welt. Für die PatientInnen ist die Behandlung kostenlos, abgesehen von wenigen Zuzahlungen, zum Beispiel für bestimmte zahnärztliche Eingriffe.
Die Kosten der Gesundheitsversorgung machen einen erheblichen Teil der Staatsausgaben aus. Für das Haushaltsjahr 2011/12 hat die Regierung dafür umgerechnet 173 Milliarden Schweizer Franken eingeplant – fast ein Fünftel ihres Budgets insgesamt.
Die Reformpläne der Regierung sehen vor, dass künftig «jeder willige Anbieter» Behandlungen, Medikamente und medizinisches Gerät an den NHS verkaufen darf. Regionale Arbeitsgemeinschaften von ÄrztInnen sollen über den medizinischen Bedarf entscheiden und zwischen den verschiedenen AnbieterInnen auswählen.
Krankenhäuser sollen zudem zu formal unabhängigen, gemeinnützigen Stiftungen werden («foundation trusts»), die ihr Budget eigenständig verwalten. Darin eingeschlossen ist die Möglichkeit, dass «defizitäre» Krankenhäuser zukünftig in Konkurs gehen und dann geschlossen werden. Im Gegenzug sollen sie PrivatpatientInnen in beliebiger Zahl behandeln und so Gewinne machen dürfen.
Angesichts der Proteste, die bis in die konservativen Reihen reichten, hat Premierminister David Cameron am Dienstag kleinere Abschwächungen der Massnahmen und eine langsamere Einführung der Veränderungen angekündet.