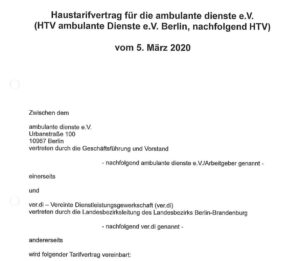In ARCHIV für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, einer Vierteljahresschrift zur Förderung von Sozial-, Jugend- und Gesundheitshilfe, herausgegeben von Prof. Dr. Peter Buttner, ist so eben das Heft 3/2012 Häusliche Pflege: Arrangements und innovative Ansätze erschienen. Dieser Band enthält u.a. den Artikel Arbeitsbedingungen professioneller und halbprofessioneller Pflege- und Assistenzkräfte in Privathaushalten von Muchtar Cheik Dib, den wir untenstehend dokumentieren.
 ARCHIV für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit Heft 3/2012
ARCHIV für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit Heft 3/2012
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.
Michaelkirchstraße 17/18 10179 Berlin-Mitte
Tel. 030 629 80-0 / Fax 030 629 80-150
www.deutscher-verein.de
Muchtar Cheik Dib
Arbeitsbedingungen professioneller und halbprofessioneller Pflege- und Assistenzkräfte in Privathaushalten
Ausgehend von Erfahrungen aus der Praxis zeigt dieser Beitrag die Problematik helfender Berufe in Privathaushalten: Ökonomisch-gesellschaftliche Interessen und sozialmentale Vorbehalte der Pflegebedürftigen führen zu einer mangelnden Wertschätzung ihrer Tätigkeit als qualifizierte Arbeit, und auch Gesetzgebung und Wissenschaft ignorieren die spezifischen Arbeitsbedingungen im „Privatbereich“.
In § 1, Absatz 1 „Zielsetzung und Anwendungsbereich“ des sogenannten Arbeitsschutzgesetzes heißt es:
„Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. Es gilt in allen Tätigkeitsbereichen.“
Absatz 2, Satz 1 schränkt sofort ein: „Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeitsschutz von Hausangestellten in privaten Haushalten.“ Warum eigentlich nicht? Einbegriffen in diesen Satz scheinen auch alle in Privathaushalten angestellten Pflege- und Assistenzkräfte zu sein. Warum? Dieses gesetzgeberische Laissez-faire erstreckt sich auf fast alle Arbeitnehmerschutzgesetze, sobald der Privathaushalt zum Arbeitsort erklärt wird – sei es das Kündigungsschutzgesetz, das Entgeltfortzahlungs-, Arbeitszeit- oder Urlaubsgesetz, um nur einige wichtige zu nennen.
Die Arbeit in Privathaushalten ist aber weit mehr als ein Ordnungsproblem. Ich arbeite seit zwanzig Jahren in einem Betrieb mit ca. 550 Teil- und Vollzeitbeschäftigten, der ambulante Assistenz- und Pflegeleistungen für behinderte und chronisch erkrankte Menschen erbringt. Klientel sind dabei Kund/innen mit Anleitungskompetenz, das heißt, die Maßgabe der Arbeitserbringung und ihre Bedingungen liegen bei den behinderten oder kranken Menschen selbst, gleichgültig wie kompetent sie sich in verschiedenen Lebensbereichen erweisen. Die Sorgfalts- und Rechenschaftspflicht den Kostenträgern wie auch dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen gegenüber liegt hingegen weiterhin beim Betrieb und den Beschäftigten. Es gibt mittlerweile Assistenzdienste mit ähnlicher Leistungsstruktur deutschlandweit in fast allen größeren Städten. Sie versuchen, möglichst passgenaue Hilfen für die Assistenz- und Pflegebedürftigen bei maximaler Gewährung von Privatheit und Intimität zu organisieren. Damit schließen diese Dienste seit Jahren eine Lücke zwischen dem sozialgesetzlichen Anspruch behinderter Menschen auf bestimmte ambulante Leistungen und der Nichtfinanzierbarkeit rein professioneller Hilfe über längere Zeiträume für Pflegekassen und Privathaushalte.
Seit zehn Jahren arbeite ich auch im Betriebsrat, d.h. an der Schnittstelle zur (Betriebs-) Öffentlichkeit bei eventuellen Problemen und Verstößen. Und obwohl ich, wie meine Kollegen und Kolleginnen, einen gewissen Schutz durch die betrieblichen Strukturen genieße, sind mir aus der Praxis wie durch Beratungen privat angestellter Pflegekräfte zahlreiche Probleme bekannt. Einige davon, die spezifisch der Arbeit in fremden Privathaushalten geschuldet sind, seien hier in Stichpunkten angesprochen. Keiner der angesprochenen Sachverhalte gilt ausschließlich und oft ist das Problem auch eines des Bewusstseins und des Habitus und nicht nur der gesetzlichen Norm. Das macht die Situation aber eher noch schwieriger.
Arbeitszeiten und kein Arbeitgeber weit und breit
Neben der Tatsache, dass in Privathaushalten sehr häufig die gesetzlichen Arbeitszeiten überschritten werden, werden Arbeitszeiten grundsätzlich nicht definiert. Das heißt, dass Pausen oft nicht eingehalten werden, Arbeitsbeginn und -ende verschoben und die Freizeit beraterisch oder pflegerisch genutzt wird – und sei es nur telefonisch. Das alles geschieht in einem Arbeitsumfeld, in dem auch an Feiertagen gearbeitet werden muss, Nachtschichten eventuell notwendig sind, Rufbereitschaften intern geregelt werden sollen.
Sobald Sie in einem Privathaushalt regelmäßig über mehrere Stunden arbeiten, müssen Sie permanent vermitteln, dass Sie eine Arbeitskraft sind. Das private Umfeld, in dem Hausherr oder -herrin eigentlich keinen Fremden haben wollen, verleitet beide Parteien zur Privatisierung des Arbeitsverhältnisses. In der Konsequenz heißt dies oft, dass der/die Arbeitnehmer/in immer für alles ansprechbar ist – denn irgendwie ist er /sie ja privat da und nicht nur wegen des Entgelts.
Diese permanente Grenzverletzung der Freizeit, die sich bei den Diensten in nichttariflichen Rufbereitschaftsmodellen und permanenten Vertretungsanfragen auswirkt (in Krankheitszeiten 10–15 Anrufe wöchentlich, sogar im eigenen Urlaub!), gilt nicht etwa nur für die sogenannten Einwohnmodelle mit 24-Stunden-Pflege. Ganz offensichtliche Fälle der Deregulierung von Arbeitszeit und Freizeit sind Agenturen, die Geld damit verdienen, dass eine Assistenz- oder Pflegekraft, häufig aus Osteuropa, für Wochen am Stück zur Arbeit vermittelt wird, bis sie dann von einer anderen abgelöst wird. Möglich ist dies nur durch eine beabsichtigte Verunklarung von Arbeits- und Freizeiten und generell der Verantwortlichkeiten. Systematisch soll verdunkelt werden, wer der zuständige Arbeitgeber ist: der Privathaushalt oder die Agentur. Keiner ist verantwortlich für die konkreten Arbeitsbedingungen vor Ort; noch weniger verantwortlich ist nur der Gesetzgeber, der diese Grauzonen zulässt.
Vielleicht kann man von einer Familie, die eine private Pflegekraft braucht, nicht erwarten, dass sie den Umfang des Mindesturlaubs oder die Pausenregelung des Arbeitszeitgesetzes kennt. Was aber erwartet werden kann, ist, dass für die Pfleger/innen, die anderen Familienmitgliedern ihre außerhäusige Arbeit erst ermöglichen, die gleichen Maßstäbe gelten, die diese für sich selbst auch anlegen und durchgesetzt wissen wollen. Alle (abhängig) Beschäftigten wissen, dass sie Pausen und Urlaub brauchen und dass sie einen Anspruch darauf haben. Wie kann dieses Wissen verloren gehen, sobald sie selbst jemanden zur Arbeit im Privathaushalt angestellt haben?
Mindestarbeitsbedingungen und kein Gesetzgeber weit und breit
Im Privaten gibt es keinen Kündigungsschutz – und so leider auch nicht im privaten Angestelltenverhältnis. Bei fehlender Arbeitszeitabsprache und -erfassung kann es nicht verwundern, dass geschuldete Lohnzahlungen genauso selten eingeklagt werden wie ausstehende Entgeltfortzahlungen.
Unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen zu Entgeltfortzahlungen, die für alle gelten, ist der Tatbestand Krankheit bei der Arbeit in Privathaushalten nicht vorgesehen. Denn außerhalb eines betrieblichen Kontextes wird es keine Krankheitsvertretung geben. Familie oder Krankenhäuser müssten in diesen Fällen kurzfristig einspringen. Das ist schon organisatorisch oft nicht machbar, d.h. Assistent/in oder Pfleger/in werden erst gar nicht krank.
Offene Haftungsfragen, die sich in diesem Kontext aufdrängen könnten, werden in anderer und direkter Form noch eklatanter deutlich und sind ohne betrieblichen Kontext oft völlig ungeklärt. Aber selbst Betriebe für ambulante Betreuung sind nicht rechtssicher, sofern sie Haftungsfragen an der Schnittstelle Privatverhältnis-Arbeitsverhältnis nicht vorher umfassend abklären. Regelmäßig haben wir im Betriebsrat Anfragen nach dem Muster, wer für die Kosten eines Autounfalls, einer misslungenen Reparatur, eines blutig endenden Hundespaziergangs oder anderer Schäden aufkommt. Assistenz- oder Pflegebedürftige versuchen immer wieder, diese auf ihre Angestellten umzulegen, denn wenn sie selbst gefahren wären oder die Sache selbst hätten reparieren können oder selbst Gassi gegangen oder eben alles selber gemacht hätten, hätte es natürlich niemals einen Schaden gegeben. Dies ist ein psychologischer Vorgang – auch ich selbst zerbreche natürlich keines meiner Weingläser, die ein anderer zerbricht.
Ein anderer kritischer Punkt in der Sicherstellung von Mindestarbeitsbedingungen ist der Schutz vor Diskriminierung und sexueller Belästigung. Es kaschiert das generelle Problem, wenn man hier immer vom Schlimmsten ausgeht, was doch eher die Ausnahme sein dürfte. Doch die Pflegenden halten sich in den vier Wänden anderer Leute mit anderen Toleranzgrenzen und Wertvorstellungen auf, die diese doch zumindest zu Hause frei artikulieren können dürfen müssen. In einem Haushalt mit unreflektierter Fremdenfeindlichkeit oder Misogynie sind Pflegekräfte unter Umständen verbalen und faktischen Übergriffen verstärkt ausgeliefert, weil jegliche dritte Instanz als Korrektiv, Hemmnis oder Zeuge fehlt. Natürlich ist mit den Angriffen nicht die gerade anwesende Frau Muster aus Musterland gemeint, aber man hatte ja auch schon andere, vor allem die letzte aus Hinterletztland. Komplizierterweise kommt hinzu, dass eine direkte Problematisierung oder gar Bearbeitung dem Betreuungsimpetus zuwiderläuft. Außerdem existiert ein Verantwortungsproblem, sobald Gelder über gesetzliche Ansprüche einfließen und die Pfleger/innen in der Sicherstellungspflicht sind. Sie können nicht einfach gehen, nur weil sie ihre Würde verletzt sehen.
Vielleicht kann man von einer Pflegekraft, die privat einen Job zum Lebensunterhalt sucht, nicht erwarten, dass sie sich im Arbeitsvertragsrecht auskennt. Was jedoch erwartet werden muss, ist ihre Forderung nach Ausfertigung und Vorlage eines Arbeitsvertrages auch auf die Gefahr hin, dass sie den Job dann nicht bekommt. Alles andere verschiebt die Probleme entweder sofort zulasten der Pflegekraft oder auf später mit hohen Folgekosten.
Das bisher Ausgeführte zeigt, dass man stundenlang über Mindestarbeitsbedingungen streiten könnte, ohne den Mindestlohn überhaupt zu tangieren.Warum eigentlich gibt es keine Beratungsstelle für Arbeitnehmer und –nehmerinnen, die in Privathaushalten arbeiten? Dies könnte eine Anlauf-, vielleicht sogar Schlichtungsstelle für strittige Fragen der grundsätzlichen Arbeitsbedingungen und auch Fragen der Entgeltzahlungen sein. In jedem Bundesland wäre sie den Ordnungsämtern angegliedert, mit juristischem und sozialpädagogischem Sachverstand ausgestattet, vielleicht auch psychologischem und medizinischem, und würde dann beworben und publik gemacht.
Der Gesetzgeber wird keine dementsprechenden Beratungsstellen einrichten, selbst wenn er gleichzeitig die Schaffung ambulanter Pflege- und Assistenzarbeitsplätze durch die Agentur für Arbeit fördert. Und natürlich wird der Gesetzgeber keine Modellarbeitsverträge ausgeben und noch viel weniger Mindestgehälter und Mindestarbeitsbedingungen definieren. Das widerspräche seiner Landschaftspflege der Grauzone, mit der er einfach „besser fährt“.
Ausbildung und Pflege und keine Wertschätzung weit und breit
Alle in privaten Haushalten angestellten Pflegekräfte erbringen Leistungen weit über ihre Fachqualifikation hinaus. Dies geschieht unabhängig vom einzelnen Qualifizierungsprofil, ob bei der ausgebildeten Pflegefachkraft, dem Pflegehelfer oder Laien. Die sogenannten Assistenzdienste erheben dies gar zum Programm: Ob Krankengymnastik oder Systemadministration der EDV, gesetzliche Betreuung oder Pediküre, Sozialarbeit, Kfz-Mechanik, Prävention bei psychischen Gefährdungen aller Art, Gartenarbeit und Familienbegleitung oder was auch immer – zuständig ist die sowieso schon anwesende Person.
Resultat dieser Vielseitigkeit ist nun aber nicht deren Anerkennung und folgerichtig dementsprechend intelligente Angebote zur Qualifikation und Regeneration (Mit Regeneration ist in diesem Beitrag nicht nur die physische Komponente gemeint, sondern auch die Wiederherstellung der sozialen Bezüge. Dies ist besonders wichtig bei migrantischen Arbeitskräften mit altem Wohn- und Bezugsort, bei häufiger Nachtschichtarbeit oder bei anstrengenden psychosozialen Settings, die einem ins Private „nachschleichen“). Resultat ist vielmehr eine gnadenlose Abwertung der erbrachten Arbeit. Und das hat Gründe: Zum einen gibt es für jede dieser Tätigkeiten Spezialist/innen, die alles zwar etwas teurer und aufwendiger, aber manchmal auch besser machen können. Dies lässt sich nicht bestreiten, doch mehr als zwei Spezialistentermine pro Tag sind bei einem schwer pflegebedürftigen Menschen nicht realisierbar. Das heißt, dass zum Beispiel auch ein Tetraplegiker nur zweimal Gymnastik und Pneumonieprophylaxe pro Woche statt sieben- bis neunmal bekommt.
Zum anderen bestehen viele dieser erbrachten Dienstleistungen aus Hilfen zu den sogenannten Aktivitäten des täglichen Lebens. Es handelt sich dabei um minderbewertete Arbeit. Die soziale Kompetenz und die „soft skills“, die nötig sind, um sie über längere Zeiträume professionell zu erbringen, werden völlig ignoriert und auch nirgends gelehrt. Einfach gesprochen: Der Wert eines Transfers eines dementen älteren Mannes mit 100 kg Gewicht und starkem Schmerzempfinden bemisst sich nach dem Wert des zeitgleichen Transfers eines 100 kg schweren Kartoffelsacks. Wenn Sie dazu ein Auto brauchen, bekommen Sie ein bisschen mehr, denn schließlich hatten Sie Investitionskosten. Dies ist nicht Fall, wenn Ihr Träger in Berlin arbeitet oder einem der Bundesländer, die die Investitionskosten der Dienste, um auch da noch zu sparen, bis heute nicht getrennt ausweisen wollen. Bei einem Pflegeheim käme niemand auf solch eine Idee – soviel zum Vorrang „ambulant vor stationär“…
Und schließlich – dies gilt bezeichnenderweise für betriebliche Strukturen genauso wie anscheinend zwangsläufig für private Beschäftigungsverhältnisse – werden die in Privathaushalten Beschäftigten weder weiterqualifiziert noch in ihrer Regeneration unterstützt. Ein Berufsbild für alles, was nicht genau Kranken- oder Altenpflege und nicht nur Hauswirtschaft ist, fehlt völlig.
Supervision, als notwendiges Instrument der Organisation der Arbeit und der Wiederherstellung der Arbeitskraft, ist auch im betrieblichen Kontext eine Seltenheit. Es gibt Träger der freien Wohlfahrtspflege, die zum Erhalt der betrieblichen Abläufe Kontingente von Supervision für Beschäftigte aus Organisation und Leitung bereithalten, während ihre gleichzeitig in privaten Haushalten Beschäftigten keine oder allenfalls in marginalem Umfang Supervisionen erhalten. Dies gilt auch für Sterbebegleitungen und die Arbeit mit schwerst pflegebedürftigen oder psychisch kranken Menschen oder in sozialen Konflikt-Settings, zu deren Auflösung es familientherapeutischer Arbeit oder zumindest externer Moderation bedürfte.
So sind die Gratifikationskrisen im stationären wie im ambulanten Pflege- und Assistenzbereich unausweichlich. Gemengelagen physisch und psychisch anstrengender Arbeit, schlechter Bezahlung und beruflicher Sackgassen führen die hier Beschäftigten immer häufiger in psychische Erkrankungen. Wenn derart flächendeckend ökonomische und sozialpolitische Anerkennung verweigert wird, bleibt nur noch das sozial deklarierte Überengagement. Für diejenigen, die ihre Selbstausbeutung noch glauben legitimieren zu müssen, wird das Burnout zum Markenzeichen der Szene. Während die Umgebung vom besonderen sozialen Gewissen der Pfleger und Pflegerinnen schwadroniert, versinken die Betroffenen aus Scham über ihre Löhne und Arbeitsbedingungen in Schweigen.
Emotionale Arbeit und keine Wissenschaft weit und breit
Seit dem Erscheinen von Arlie Russell Hochschilds soziologischer Studie „The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling“ gibt es kaum weiterführende Arbeiten zum Begriff der emotionalen Arbeit. In ihrer Studie hatte Hochschild auf Grundlage von Interviews den manipulativen Umgang mit eigenen Gefühlen zugunsten des Jobs untersucht. Zum einen widmete sie sich dabei der Freundlichkeit von Stewardessen, ihrem Bemühen um Vertraulichkeit im Flugzeug als Wohnzimmer zu Beginn des Billigflugtourismus. Zum anderen analysierte sie die Arbeit von Rechnungseintreibern eines Inkassobüros. Deren Instrumente, um die Klientel zur Zahlung offener Rechnungen zu motivieren, lagen am anderen Ende der Skala menschlicher Überredungskunst. Für beide Berufsgruppen war dabei das berufsmäßige Kontrollieren eigener Gefühle notwendig und die zielgerichtete Herstellung anderer Gefühle bei den Kund/innen zum Wohle der Firma.
Unabgegolten bleibt die emotionale Arbeit bis heute; vor allem in allen Fragen der Regeneration der Arbeitskraft. Dies ist umso augenfälliger, als die Rede von der Dienstleistungsgesellschaft, die auch in Deutschland realisiert werden müsse, seit den 1990er-Jahren ohne qualitative Bestimmung des Begriffs Dienst auskommt. Dieser Diskurs wollte nie neue Berufsbilder schaffen, sondern vielmehr Qualifizierungshierarchien nach unten öffnen und gleichzeitig verschleiern.
Wichtiger als die politischen Halbheiten erscheint mir aber die Folge emotionaler Arbeit ohne offiziellen Preis und Wert. Die neueste Rede der Arbeitspsychologie handelt vom „Coolout“ als Strategie des Pflegepersonals. Dies nannte man früher Zynismus und es ist vielleicht noch die „gesündeste“ Form persönlicher Deformation. Es scheint so, als sei diese Kälte die letzte Rettung der helfenden Berufe gegenüber den Umständen. Weil medizinische wie gesetzliche Vorgabe und Erwartung nicht mehr mit der pflegerischen Realität in Übereinstimmung zu bringen sind, werden Legitimationen kreiert, um sich selbst noch in die Augen sehen zu können (Kersting, Karin: „Coolout“ in der Pflege. Eine Studie zur moralischen Desensibilisierung, Frankfurt a.M. 2011). Dabei wird die psychische Gesundheit ganzer Berufsgruppen zerschlissen. Und dennoch fehlt seit Jahren jede Reaktion darauf, dass kaum ein/e Beschäftigte/r in den helfenden Berufen diese Arbeit bis zur Berentung durchhalten will oder kann.
Die neuen politischen Ansätze zur Bewertung von Reproduktionsarbeit, wie sie die Gender Studies und daraus folgende Umwertungsdebatten angestoßen haben, sind auch wissenschaftlich nur marginal. Der „care drain“ des Pflegepersonal aus Entwicklungsländern in die Industrienationen schafft Tatsachen, die die Politik sich in den Netzen ihrer Migrationspolitik verheddern lässt. Reflexion und Bearbeitung finden hier mehr im künstlerischen und filmischen Bereich als in der Soziologie statt (Siehe z.B.: Beyond Re/Production. Mothering. Katalog zur Ausstellung 25. Februar – 25. April 2011 Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, hrsg. von Felicita Reuschling, Berlin 2011).
Zurück zum Alltag. Oft, gerade bei älteren Menschen, die pflegebedürftig werden, muss der Pflegebedarf in ihrer angestammten Umgebung, ihrer Wohnung erbracht werden. Alles erinnert an die Zeit, in der es noch ohne fremde Hilfe ging. Jeder Umstand, jede Veränderung, sei es benötigter Platz für ein Pflegebett, einen Lifter oder gar ein Umbau, erinnert an die Insuffizienz und erzeugt Ungeduld. Damit müssen diejenigen umgehen, die dort arbeiten. Jeder kennt das: die eigene Unordnung ist immer Ordnung, sauber der eigene Dreck, praktisch die eigene Logik. Jede Verbesserung ist hier eine Verschlechterung, weil sie eine Veränderung darstellt. Mit all dem müssen die Pflegekräfte umgehen, und da es sich nicht um das Justieren einer Maschine handelt, immer wieder.
Trotz aller Vorleistung sind die helfenden Berufe, besonders im Privatsektor, auf verlorenem Posten: Das ökonomisch-gesellschaftliche wie das sozial-mentale Interesse liegt gerade darin, diese Arbeit gar nicht erst als Arbeit anzuerkennen. Wenn die Kostenträger nur ahnten, was an Leistungserbringung unabgegolten bleibt, müssten sie Bankrott anmelden. Wenn ich als Betroffener anerkennen würde, dass ich jemanden für die
manchmal einfachsten Aktivitäten des täglichen Lebens brauche, würde ich meine Bedürftigkeit anerkennen. Und wenn ich die Kompensation meiner Bedürftigkeit als Arbeit anerkenne, bestätige ich diese gleich noch einmal – dafür geb´ ich doch kein Geld aus!