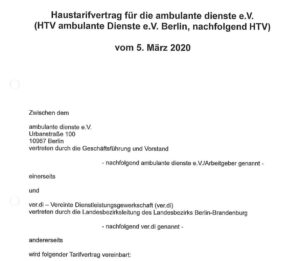Ver.di will bessere Arbeitsbedingungen in Kliniken per Tarifvertrag durchsetzen
Ein Gespräch mit Ellen Paschke (Mitglied im ver.di-Bundesvorstand und Leiterin des Fachbereichs Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen)
Am Dienstag sind in Kassel mehrere hundert Betriebsräte, Vertrauensleute und hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre aus dem Krankenhausbereich zusammengekommen, um über die Kampagne »Der Druck muß raus« zu diskutieren. Mit welchem Ziel?
Die Situation in den Krankenhäusern ist unerträglich: Es gibt viel zu wenig Personal, die Fallzahlen und der Leistungsdruck nehmen zu. Die Folge ist, daß Menschen, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten, selbst krank werden. Das darf nicht sein. Deshalb hat eine große Betriebs- und Personalrätekonferenz im November vergangenen Jahres beschlossen, die Debatte über einen Tarifvertrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu eröffnen. Die Vereinbarung soll trägerübergreifend gelten – also für Kliniken in öffentlicher, kirchlicher und privater Trägerschaft. Seit April wurden die Beschäftigten dazu befragt, und auf dieser Grundlage hat die Kasseler Konferenz konkrete Forderungen formuliert.
Welche sind das?
Ein Tarifvertrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz müßte zum Beispiel eine Regelung zu Überlastungsanzeigen enthalten. Diese werden von Beschäftigten in Überlastungssituationen geschrieben, um sich rechtlich abzusichern. Von den Arbeitgebern werden die Anzeigen üblicherweise aber nur weggeheftet. Wir wollen, daß sie künftig zu Konsequenzen führen. Bei eklatantem Personalmangel soll eine paritätische Kommission über die Schließung von Betten oder ganzer Stationen entscheiden können.
Ein weiteres Problem ist die extreme Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Beschäftigte schieben zum Teil 600 bis 700 Überstunden vor sich her, die sie gar nicht mehr abbauen können. Wir fordern daher eine Begrenzung der Überstunden. Es kommt sehr häufig vor, daß Kollegen aus der Freizeit in den Betrieb gerufen werden. Diese Arbeitszeiten müssen höher bewertet werden. Wir wollen Mindestbesetzungen auf den Stationen und in den Abteilungen festschreiben. In der Nacht müssen mindestens zwei Krankenschwestern auf Station sein. Außerdem wollen wir einen Tarifvertrag über die Ausbildungsqualität in den Kliniken erreichen. Auszubildende dürfen nicht länger Lückenbüßer für den Personalmangel sein. Wir wollen, daß sie nicht mehr auf die Stellenpläne angerechnet werden.
Da haben Sie sich ja eine Menge vorgenommen. Wie will ver.di das durchsetzen?
Wir werden diese Forderungen nun intensiv in den Betrieben diskutieren. Am 9. September werden die Tarifkommissionsmitglieder aller Bereiche – es gibt für die Krankenhäuser ja keinen Branchentarifvertrag, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Vereinbarungen – auf einer weiteren Konferenz entscheiden, wann wir in Aktion treten. Es ist klar: Diesen Tarifvertrag kriegen wir nicht geschenkt. Die Beschäftigten zu mobilisieren geht aber nicht auf Knopfdruck. Ziel ist es, im Herbst arbeitskampffähig zu sein. Wenn wir für die Diskussionen in den Betrieben – betroffen sind immerhin 1,1 Millionen Menschen – länger brauchen, dann werden wir uns die Zeit dafür nehmen.
Wie gehen Sie mit dem Problem um, daß die Ausgangslage in den Häusern sehr unterschiedlich ist?
Die Bedingungen sind zwar verschieden, aber die politisch verursachte Unterfinanzierung ist in allen Krankenhäusern die gleiche. Überall wird im Namen der Wettbewerbsfähigkeit Personal abgebaut, werden die Arbeitsbedingungen verschlechtert. Daher gilt es, sich gemeinsam dagegen zur Wehr zu setzen.
Die Kampagne »Der Deckel muß weg« im Jahr 2008 hat ver.di gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) organisiert. Dieses Mal richten sich die Forderungen direkt an die Krankenhausträger. Ist das Bündnis mit den Arbeitgebern damit aufgekündigt?
Von der damaligen Kampagne haben die Kliniken finanziell profitiert. Das war auch unser gemeinsames Ziel. Aber bei den Beschäftigten ist das nicht angekommen. Von den seinerzeit versprochenen 17000 Pflegestellen sind weniger als 4000 tatsächlich geschaffen worden. Und auch das wurde nicht zur Entlastung, sondern zur Ausweitung der Leistungen genutzt. Unsere Schlußfolgerung daraus ist: Wir geben keinen Blankoscheck mehr, sondern kämpfen erst für die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen. Danach können wir gerne wieder gemeinsam auf die Straße gehen, um für die nötige Finanzausstattung zu streiten.